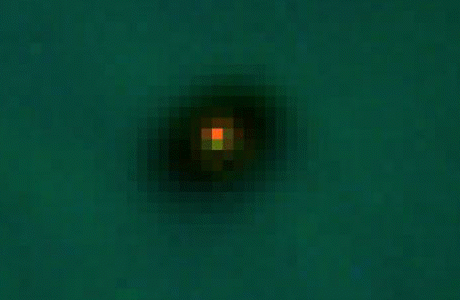 Anhang 4:
Anhang 4:
Der Ursprung des Sonnensystems
von Frank Crary, CU Boulder
Nachfolgend ein kurzer Abriß über die aktuelle Theorie
über die Ereignisse in der frühen Geschichte des
Sonnensystems:
- Eine Wolke interstellaren Gases und/oder Staub (der
„Sonnennebel“) wird gestört und kollabiert unter seiner
eigenen Gravitation. Die Störung könnte etwa von der
Schockwelle einer nahegelegenen Supernova herrühren.
- Während die Wolke kollabiert, erhitzt und komprimiert sie das
Zentrum. Sie heizt sich stark genug auf, um den Staub zu verdampfen.
Die erste Phase des Kollaps dauerte vermutlich weniger als 100.000
Jahre.
 |
|---|
Gabelstaplerführerschein
Die Staplerausbildung bei AS Gabelstapler berechtigt ohne Einschränkungen zum Führen aller Stapler nach DIN ISO 5053.
|
|
- Das Zentrum erhitzt sich genug, um ein Protostern zu werden, und Rest des
Gases umkreist/umfließt ihn. Bei weitem das meiste Gas
fließt und ergänzt den sich bildenden Stern, aber es rotiert.
Die Zentrifugalkraft verhindert, daß Teile des Gases den in
Bildung begriffenen Stern erreicht. Statt dessen bildet sich eine
Akkretionsscheibe um den Stern. Die
Scheibe strahlt ihre Energie ab und kühlt aus.
- Erster Haltepunkt. Abhängig von Details könnte der
gasumflossene Stern/Protostern instabil sein und unter seiner eigenen
Schwerkraft in sich zusammenstürzen. Das ergibt einen Doppelstern.
Wenn das nicht passiert ...
- Das Gas kühlt sich soweit ab bis Metall und Gestein und (weit ab vom
sich bildenden Stern) Eis in kleine Partikel auskondensieren. (Teile
des Gases kehren zurück zu Staub). Die Metalle kondensieren sehr
bald nach Bildung der Akkretionsscheibe aus (etwa vor 4,55-4,56
Milliarden Jahren nach Isotopenbestimmungen an bestimmten Meteoren);
das Gestein kondensiert etwas später (etwa vor 4,4 - 4,55
Milliarden Jahren).
- Die Staubpartikel kollidieren und formen größere Teilchen.
Dies setzt sich bis zur Größe von Felsbrocken und kleinen
Asteroiden fort.
- Fortlaufendes Wachstum. Wenn Körper groß genug geworden sind,
um eine nicht unerhebliche Schwerkraft auszuüben, steigt die
Geschwindigkeit ihres Wachstums. Ihre Schwerkraft (obwohl noch sehr
klein) gibt ihnen einen Vorsprung gegenüber kleineren Teilchen;
sie ziehen weitere, kleinere Partikel an sich und binnen sehr kurzer
Zeit haben sie die gesamte feste Masse in der Nähe ihrer
Umlaufbahn angesammelt. Wie groß sie letztlich werden,
hängt von der Entfernung zum Stern und von der Dichte und
Zusammensetzung des protoplanetarischen Nebels ab. Theorien
gehen von der Größe eines schweren Asteroiden bis
Mondgröße im Innern und ein- bis
fünfzehnfacher Erdgröße im
äußeren Sonnensystem aus. Es gäbe einen gewaltigen
Sprung in der Größe irgendwo zwischen den Umlaufbahnen von
Mars und Jupiter:
Die Energie der Sonne hätte ein
Auskristallisieren von Eis in der Umgebung verhindert, so daß
feste, klumpende Masse jenseits dieser kritischen Entfernung zur
Sonne viel häufiger wäre. Man glaubt, die Bildung dieser
„Planetenvorläufer“ dauerte ein paar hunderttausend bis
etwa zwanzig Millionen Jahre, wobei die äußeren am
längsten zur Formung benötigten.
- Zwei Punkte und der zweite Halt. Wie groß waren diese Protoplaneten
und wie schnell formten sie sich? Etwa zur selben Zeit, also etwa eine
Million Jahre nach Abkühlen des Nebels würde der Stern einen
sehr starken Sonnenwind erzeugen, der das gesamte verbliebene Gas im
protoplanetaren Nebel fortfegen würde. Wenn ein Protoplanet
früh groß genug wäre, würde er das Gas des Nebels
anziehen und sich zum Gasriesen entwickeln. Wenn nicht, würde er
aus Stein und Eis bestehen.
- Zu diesem Zeitpunkt würde sich das Sonnensystem aus massiven,
protoplanetaren Körpern und Gasriesen bestehen. Die
„Zwergplaneten“ würden langsam miteinander kollidieren
und schwerer werden.
- Schließlich nach ein paar zehn bis hundert Millionen Jahren
verbleibt man bei etwa zehn Planeten in stabilen Umlaufbahnen, und das
ist das Sonnensystem. Diese Planeten und ihre Oberflächen
können stark von der letzten Kollision gezeichnet sein (z.B. der
hauptsächlich aus Metall bestehende
Merkur oder der
Mond).
Bemerkung: Dies war die gültige Theorie in ihrer Form vor
Entdeckung extrasolarer Planeten. Die Entdeckungen
passen nicht zur theoretischen Vorhersage. Das kann zum einen an
Beobachtungseigenheiten (seltsame Sonnensysteme könnten einfacher von
der Erde aus zu beobachten sein) oder an Problemen mit der Theorie liegen
(möglicherweise subtile Einzelheiten, jedoch nichts
Grundsätzliches).
Mehr über Planetenentstehung
Es ist vorstellbar, Sonnenschutzfolien auf ungewöhnliche Weise einzusetzen, um den Ursprung des
Sonnensystems besser erforschen zu können. Hintergrund ist der
Sonnenwind, den man mit Hilfe einer Folie aufnimmt, die aufgespannt wie ein Segel wirkt. Der Wind würde
eine Sonde im luftleeren Raum auf sehr hohe Geschwindigkeiten bringen. Darüber hinaus schützt ein solches Segel gleichzeitig die
Technik vor der direkten Sonneneinstrahlung. Bis zu einer bestimmten Entfernung ließe sich das Ganze sogar per Funk oder Programmierung steuern.
Als unser Sonnensystem entstand, wurden unvorstellbare Energien frei, gerade im elektromagnetischen Bereich. Vermutlich könnte kein von
Menschenhand erschaffenes Gerät eine solche Messung überstehen, was Techniker aber nicht daran hindert, mit Hilfe von Computern
Hochrechnungen anzustellen. Ebenso unvorstellbar kleine Energieströme gibt es. Nicht wahrnehmbar, aber messbar. Im elektrotechnischen
Bereich misst man beispielsweise mit einem Impedance Analyzer den elektrischen Widerstand für
Wechselstrom in kleinsten Stärken. Ob Obst, wie beispielsweise Äpfel und Bananen, oder auch Gemüse einen elektrischen Widerstand
hat, könnte man damit nachweisen.
Inhalt
... Anhänge
... Zeitablauf
... Ursprung
... Sprache
... Originalseite
Impressum, © Text: Frank Crary, konvertiert zur HTML von
Bill Arnett, übersetzt von
Christoph Högl, gepflegt von
Michael Wapp; zuletzt ergänzt:
10. April 2014